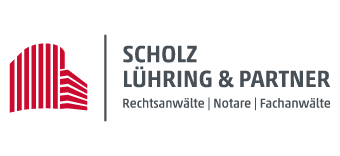Bei der Heirat blicken die meisten Paare auf das persönliche Miteinander und ihre gemeinsame Zukunft. Mit der Eheschließung gehen jedoch auch eine Vielzahl von Rechten und Pflichten einher. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich frühzeitig auch mit den rechtlichen Folgen der Ehe auseinanderzusetzen. Durch einen notariellen Ehevertrag lassen sich diese an die konkreten persönlichen Lebensverhältnisse anpassen – eine maßgeschneiderte Lösung für gute und auch schlechte Zeiten.
Rechtzeitig handeln, statt später streiten
Ein Ehevertrag wird fälschlicherweise oft mit Trennung in Verbindung gebracht, dabei handelt es sich um ein Instrument der Vorsorge und Absicherung. „Ein Ehevertrag kann Streit vorbeugen und finanzielle Risiken minimieren, indem die vermögensrechtlichen Folgen einer Eheschließung klar, fair und individuell ausgestaltet werden“, erklärt Robert Jakob, Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen-Anhalt.
Zwar ist es auch möglich, einen Ehevertrag erst anlässlich einer Trennung als sogenannte Trennungs- oder Scheidungsfolgenvereinbarung zu schließen. In diesem Zeitpunkt gestaltet sich eine friedliche Lösungsfindung jedoch oft schwieriger oder ist gar unmöglich. Ehepaare sollten sich daher rechtzeitig mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Partnerschaft auseinandersetzen.
Gilt das überhaupt für uns?
Ein vorsorgender Ehevertrag ist nicht nur für Vermögende und Unternehmer sinnvoll. „Ohne individuelle Ausgestaltung greifen die gesetzlichen Regelungen, die den Vorstellungen der Ehegatten nicht immer entsprechen. Fachkundige Beratung durch die Notarin oder den Notar ist hier unerlässlich“, betont Jakob.
Sofern die Eheleute keine andere Vereinbarung treffen, gilt beispielsweise der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Der Güterstand regelt die Zuordnung des Vermögens der Eheleute während und nach der Ehe. Im gesetzlichen Güterstand gehört das Vermögen, das jeder Ehegatte während der Ehe erwirbt, ihm allein. Auch haftet jeder Ehegatte nur für seine eigenen Schulden. Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft findet jedoch ein Ausgleich des Vermögenszuwachses während der Ehe statt. Dies ist in vielen Fällen nicht interessengerecht oder aus anderen Gründen nicht gewollt. Neben dem Güterstand können auch Regelungen über den nachehelichen Unterhalt, das Sorgerecht für gemeinsame Kinder, die eheliche Wohnung oder die Absicherung im Alter – insbesondere den Versorgungsausgleich – getroffen werden.
Notarielle Beratung als Qualitätsmerkmal
Gerade bei Sachverhalten mit internationalem Bezug, Patchwork-Familien, Einkommens- oder Vermögensunterschieden oder Unternehmensbezug kann sich die Gestaltung des Ehevertrages als kompliziert erweisen. Eheverträge müssen ausgewogen sein und dürfen nicht unangemessen eine Seite belasten. Die unparteiische Beratung und Beurkundung durch eine Notarin oder einen Notar stellt sicher, dass ein Ehevertrag diesen Anforderungen gerecht wird. Sie gewährleistet, dass die Vorstellungen des Ehepaares rechtssicher umgesetzt werden und die getroffenen Vereinbarungen den tatsächlichen Lebensumständen entsprechen.
„Jeder Ehevertrag muss notariell beurkundet werden. Schon aus diesem Grund sind alle Notarinnen und Notare Spezialisten auf diesem Gebiet. Die rechtliche Beratung beider Eheleute ist dabei inklusive und gehört zur Beurkundung dazu. Die zusätzliche Beauftragung einer Anwältin oder eines Anwalts ist somit nur dann erforderlich, wenn ein Ehepartner im Einzelfall auch eine einseitige parteiische Beratung wünscht,“ stellt Jakob eine immer wieder und erst kürzlich in der Zeitschrift Finanztest (Ausgabe 11/2024) verbreitete Fehlinformation richtig. „Als unparteiische Spezialisten sind Notarinnen und Notare für eine einvernehmliche Lösung im beiderseitigen Interesse die richtigen Ansprechpartner.“